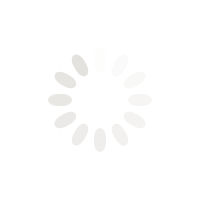Mario Vargas Llosa – Nobelvorlesung
English
English [pdf]
Swedish
Swedish [pdf]
French
French [pdf]
German
German [pdf]
Spanish
Spanish [pdf]
7. Dezember 2010
Ein Lob auf das Lesen und die Fiktion
Mit fünf Jahren habe ich in der Klasse von Bruder Justiniano in der Schule De La Salle von Cochabamba, Bolivien, lesen gelernt. Es ist das wichtigste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist. Beinahe siebzig Jahre später erinnere ich mich noch deutlich, wie diese Magie, die Worte der Bücher in Bilder zu übersetzen, mein Leben bereichert hat: die Grenzen von Zeit und Raum zu durchbrechen, mit Kapitän Nemo zwanzigtausend Meilen unter dem Meer zu reisen, Seite an Seite mit d’Artagnan, Athos, Portos und Aramis gegen die Intrigen zu kämpfen, von denen sich die Königin zu Zeiten des hinterlistigen Richelieu bedroht sieht, oder als Jean Valjean den bewußtlosen Marius auf dem Rücken durch die Tiefen von Paris zu tragen.
Das Lesen verwandelte Traum in Leben und Leben in Traum und machte mir kleinem Kerl das Universum der Literatur zugänglich. Meine Mutter erzählte mir, meine ersten selbstgeschriebenen Texte seien Fortsetzungen der Geschichten gewesen, die ich las, weil es mich traurig machte, daß sie endeten, oder weil ich ihren Schluß verbessern wollte. Und vielleicht tat ich genau das unbewußt mein ganzes Leben lang: die Geschichten verlängern, die meine Kindheit mit Überschwang und Abenteuern erfüllten, während ich heranwuchs, reifer und älter wurde.
Gern hätte ich meine Mutter hier dabei, die zu Tränen gerührt die Gedichte von Amado Nervo und Pablo Neruda las, und auch meinen Großvater Pedro mit seiner großen Nase und spiegelnden Glatze, der meine ersten Verse pries, und meinen Onkel Lucho, der mich so sehr ermutigte, mich mit Leib und Seele aufs Schreiben zu konzentrieren, auch wenn die Literatur zu jener Zeit an jenem Ort ihre Adepten denkbar schlecht ernährte. Mein ganzes Leben lang hatte ich Menschen wie sie an meiner Seite, die mich liebten und bestärkten und mich mit ihrem Vertrauen ansteckten, wenn mir selbst die Zweifel kamen. Ich verdanke es ihnen, dazu fraglos meiner Dickköpfigkeit und ein wenig Glück, daß ich einen Großteil meiner Zeit der Leidenschaft, dem Laster, der Wonne des Schreibens widmen, ein paralleles Leben erschaffen konnte, das Zuflucht bietet vor allen Widrigkeiten, in dem das Außergewöhnliche normal und das Normale außergewöhnlich ist, in dem das Chaos sich lichtet, das Häßliche verschönt, der Augenblick verewigt und der Tod ein vorübergehendes Schauspiel wird.
Es war nicht leicht, Geschichten zu schreiben. Wurden sie zu Worten, verdorrten die Vorhaben auf dem Papier, verflüchtigten sich Einfälle und Bilder. Wie sie wiederbeleben? Glücklicherweise gab es die Meister, von denen man lernen und deren Beispiel man folgen konnte. Flaubert lehrte mich, daß Talent aus hartnäckiger Disziplin und viel Geduld besteht. Faulkner, daß es die Form ist – Stil und Struktur –, die ein Thema bedeutend oder unbedeutend macht. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Thomas Mann, daß Fülle und Ambition eines Romans ebenso wichtig sind wie stilistisches Geschick und Erzählstrategie. Sartre, daß Worte Taten sind und Romane, Theaterstücke oder Essays, die der Aktualität und ihren besten Absichten Stimme verleihen, den Lauf der Geschichte verändern können. Camus und Orwell, daß eine Literatur ohne Moral inhuman ist, und Malraux, daß Heroismus und Epos in der Aktualität ebenso ihren Platz haben wie zu Zeiten der Argonauten, der Odyssee und der Ilias.
Würde ich in dieser Rede alle Schriftsteller zitieren, denen ich etwas oder vieles schulde, würden ihre Schatten uns in Dunkelheit tauchen. Es sind unzählige. Und sie weihten mich nicht nur in die Geheimnisse des Erzählens ein, mit ihnen ergründete ich die Abgründe des Menschlichen, bewunderte Heldentaten und entsetzte mich über Ungeheuerlichkeiten. Die hilfreichsten Freunde, die mich in meiner Berufung bestärkten, waren diejenigen, in deren Büchern ich entdeckte, daß noch unter den schlimmsten Verhältnissen Hoffnung besteht und es sich zu leben lohnt, und sei es nur, weil wir ohne Leben nicht lesen und keine Geschichten erfinden könnten.
Manchmal fragte ich mich, ob in Ländern wie dem meinen, wo die Zahl der Leser gering und die der Armen, Analphabeten und Ungerechtigkeiten hoch und Kultur das Privileg einiger wenigen ist, das Schreiben nicht ein solipsistischer Luxus ist. Doch diese Zweifel brachten meine Berufung nie zum Schweigen, und so habe ich immer geschrieben, selbst in jenen Phasen, in denen die rein pekuniären Tätigkeiten beinahe meine ganze Zeit ausfüllten. Und ich glaube, das war richtig so, denn wäre für ein Erblühen der Literatur in einer Gesellschaft zunächst Bildung, Freiheit, Wohlstand und Gerechtigkeit erforderlich, hätte es niemals Literatur gegeben. Vielmehr danken wir es jedoch der Literatur und dem Bewußtsein, das sie formt, den Sehnsüchten und Wünschen, die sie weckt, der Ernüchterung, mit der wir nach der Reise in eine schöne Phantasiewelt in die Wirklichkeit zurückkehren, daß die Zivilisation inzwischen nicht mehr ganz so grausam ist wie zu den Zeiten, als die ersten Geschichtenerzähler das Leben mit ihren Fabeln zu vermenschlichen begannen. Wir wären schlechter als wir sind, ohne die guten Bücher, die wir gelesen haben, konformistischer, weniger wach und aufbegehrend, und unser kritischer Geist, der Motor jeden Fortschritts, würde gar nicht existieren. Genauso wie das Schreiben ist das Lesen ein Protest gegen die Unzulänglichkeiten des Lebens. Wer in der Fiktion sucht, was ihm selbst fehlt, drückt damit aus, ohne es so sagen oder auch nur wissen zu müssen, daß das Leben an sich uns nicht genügt, um unseren Durst nach dem Absolutem, diesem grundlegenden Zug des Menschseins, zu befriedigen, und daß das Leben besser sein müßte. Wir denken uns Geschichten aus, um auf irgendeine Weise die vielen Leben zu leben, die wir gern leben würden, während wir gerade mal über eins verfügen.
Ohne Fiktionen wären wir uns nicht so sehr der Bedeutung der Freiheit für ein lebenswertes Leben bewußt, und in welche Hölle es sich verwandelt, wenn ein Tyrann, eine Ideologie oder Religion sie mit Füßen tritt. Wer Zweifel daran hegt, daß die Literatur uns nicht nur von Schönheit und Glückseligkeit träumen läßt, sondern auch auf jede Form der Unterdrückung aufmerksam macht, der soll sich fragen, warum all jene Regime, die das Verhalten ihrer Bürger von der Wiege bis ins Grab unter Kontrolle halten wollen, solche Furcht vor der Literatur haben, daß sie zu ihrer Unterbindung Zensursysteme einführen und die unabhängigen Schriftsteller so argwöhnisch überwachen. Sie tun es, weil sie wissen, welches Risiko es birgt, der Phantasie in den Büchern freien Lauf zu lassen, wie aufrührerisch die Fiktion werden kann, wenn der Leser die Freiheit, die sie ermöglicht und die in ihr herrscht, mit dem Obskurantismus und der Angst vergleicht, denen er sich in der wirklichen Welt ausgesetzt sieht. Ob sie es wollen oder nicht, ob sie es wissen oder nicht, Geschichtenerzähler verbreiten mit ihren Fabulierungen Unzufriedenheit, indem sie zeigen, daß die Welt mangelhaft ist, daß das imaginäre Leben so viel reicher ist als die tägliche Routine. Schlägt diese Erkenntnis erst einmal Wurzeln in Sensibilität und Bewußtsein der Menschen, sind sie schwieriger zu manipulieren, akzeptieren sie nicht so leicht die Lügen derer, die ihnen weismachen wollen, zwischen Gitterstäben, Inquisitoren und Kerkermeistern lebe es sich sicherer und besser.
Die gute Literatur baut Brücken zwischen den unterschiedlichsten Personen, was wir durch sie an Genuß, Leid oder Verblüffung erleben, vereint uns unabhängig von Sprachen, Glaubensvorstellungen, Bräuchen, Gewohnheiten und Vorurteilen, die uns trennen. Wenn der weiße Wal Kapitän Ahab ins Meer hinabzieht, wird jeder Leser ergriffen sein, ob in Tokio, Lima oder Timbuktu. Wenn Emma Bovary das Arsen schluckt, Anna Karenina sich vor den Zug wirft oder Julien Sorel das Schafott besteigt, wenn der Bibliothekar Juan Dahlmann in Borges Erzählung Der Süden aus der Landschenke tritt, um sich mit einem Messerhelden zu duellieren oder wenn wir merken, daß alle Bewohner in Pedro Páramos Dorf Comala tot sind, erschaudert der Leser, ob er an Buddha, Konfuzius, Jesus Christus, Allah glaubt oder Agnostiker ist, ob er Anzug und Krawatte, Djellaba, Kimono oder Pluderhosen trägt. Die Literatur schafft eine Brüderlichkeit innerhalb der menschlichen Vielfalt und läßt Grenzen verschwinden, die Ignoranz, Ideologien, Religionen, Sprachen und Dummheit zwischen den Menschen errichten.
Alle Epochen kannten ihre jeweiligen Schrecken, und unsere ist die der Fanatiker, Terroristen, Selbstmordattentäter, einer alten Spezies, die davon überzeugt ist, daß man durch Morden ins Paradies gelangt, daß das Blut von Unschuldigen kollektive Schmach reinwäscht, Ungerechtigkeit gutmacht und den wahren Glauben erzwingen kann. Zahllose Menschen fallen täglich an vielen Orten der Welt denen zum Opfer, die sich im Besitz absoluter Wahrheiten glauben. Wir dachten, daß sich nach dem Zusammensturz der totalitären Mächte ein friedliches, pluralistisches Zusammenleben unter Achtung der Menschenrechte durchsetzen und die Welt Holocauste, Genozide, Invasionen und Vernichtungskriege hinter sich lassen würde. Nichts von dem ist geschehen. Neue Formen der Barbarei wuchern, vom Fanatismus geschürt, und angesichts der vehementen Zunahme von Massenvernichtungswaffen ist nicht auszuschließen, daß irgendeine obskure Gruppe wahnwitziger Erleuchteter eines Tages eine nukleare Katastrophe auslöst. Man muß ihnen entgegentreten, Einhalt gebieten, sie besiegen. Es sind nicht viele, auch wenn der Donnerhall ihrer Verbrechen über den ganzen Planeten hallt und die von ihnen verursachten Alpträume uns mit Grauen erfüllen. Wir dürfen uns nicht von denen einschüchtern lassen, die uns die auf dem langen Weg der Zivilisation mühsam erkämpfte Freiheit entreißen wollen. Verteidigen wir die liberale Demokratie, die trotz all ihrer Beschränkungen doch immer noch Pluralismus, Zusammenleben, Toleranz, Wahrung der Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Legalität, freie Wahlen, Regierungswechsel bedeutet, all das, was uns dem primitiven Lebensstadium enthoben hat und uns – auch wenn wir es nie erreichen werden – dem schönen, perfekten Leben näherbringt, das die Literatur vorgaukelt, dem Leben, das wir uns nur verdienen, indem wir es erfinden, schreiben und lesen. Indem wir uns fanatischen Mördern entgegenstellen, verteidigen wir unser Recht, zu träumen und unsere Träume Wirklichkeit werden zu lassen.
In meiner Jugend war ich, wie viele Schriftsteller meiner Generation, Marxist, und ich glaubte daran, daß der Sozialismus das Heilmittel für die Ausbeutung und sozialen Ungerechtigkeiten wäre, die in meinem Land, in Lateinamerika und im Rest der Dritten Welt herrschten. Meine Enttäuschung über Staatsherrschaft und Kollektivismus und meine Entwicklung hin zum Liberaldemokraten, der ich jetzt bin – oder zu sein versuche – war ein langer und schwieriger Prozeß, dem Ereignisse vorangingen wie die Umwandlung der kubanischen Revolution, die mich anfangs begeistert hatte, in das autoritäre, hierarchische Modell der Sowjetunion, das Zeugnis der Dissidenten, das durch die Stacheldrahtumzäunungen der Gulags zu uns gelangte, der Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei, und zu dem Denker beitrugen wie Raymond Aron, Jean-François Rével, Isaiah Berlin und Karl Popper, denen ich meinen neuen Blick auf die demokratische Kultur und die offene Gesellschaft verdanke. Diese Lehrmeister bewiesen beispielhafte Klarsicht und Integrität zu einer Zeit, in der die westliche Intelligenzija, aus Frivolität oder Opportunismus, ganz offenbar im Bann des Sowjetsozialismus oder, schlimmer noch, des blutrünstigen Hexensabbats der chinesischen Kulturrevolution stand.
Als Kind träumte ich davon, eines Tages nach Paris zu reisen, denn die französische Literatur übte einen solchen Zauber auf mich aus, daß ich dachte, erst wenn ich dort leben und die gleiche Luft atmen würde wie Balzac, Stendhal, Baudelaire und Proust, könnte ich ein richtiger Schriftsteller werden, während ich in Peru immer nur ein kleiner Sonntagsschreiber bliebe. Und tatsächlich schulde ich Frankreich, der französischen Kultur, so unvergeßliche Lehren wie die, daß die Literatur ebenso sehr Berufung wie Disziplin, Arbeit und Beharrlichkeit ist. Ich kam dorthin, als Sartre und Camus noch lebten und schrieben, zu Zeiten von Ionesco, Beckett, Bataille und Cioran, als das Theater von Bertolt Brecht und die Filme von Ingmar Bergman populär waren, das TNP (Théâtre Nationale Populaire) von Jean Vilar und das Odéon-Theater von Jean-Louis Barrault, die Nouvelle Vague und der Neue Roman, als André Malraux seine Reden hielt, jene wundervollen Prosastücke, und General de Gaulle Pressekonferenzen gab, vielleicht die spektakulärsten Theateraufführungen des damaligen Europas, und olympische Donnerschläge austeilte. Doch ich glaube, am dankbarsten bin ich Frankreich für die Entdeckung Lateinamerikas. Dort lernte ich, daß Peru Teil einer großen Gemeinschaft ist, die eine ähnliche Geschichte, Geographie, soziale Problematik und Politik verbindet, eine gewisse Lebensform und die kraftvolle Sprache, die dort gesprochen und geschrieben wird. Die in eben diesen Jahren eine üppige neue Literatur hervorbrachte. Dort las ich Borges, Octavio Paz, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso und viele mehr, deren Texte die spanischsprachige Prosa revolutionierten und Europa und vielen anderen Teilen der Welt zeigten, daß Lateinamerika nicht nur der Kontinent der Staatsstreiche, Operetten-Caudillos, bärtigen Guerillakämpfern, der Mambo-Rasseln und des Cha-cha-cha war, sondern auch Ideen, künstlerische Formen und literarische Fiktionen hervorbrachte, die über jede Folklore hinausgingen und eine universelle Sprache sprachen.
Lateinamerika hat seitdem, nicht ohne manches Stolpern und Entgleisen, Fortschritte gemacht, auch wenn immer noch gilt, was César Vallejo schrieb: Es gibt sehr viel zu tun, Brüder. Wir haben unter weniger Diktaturen zu leiden als früher, es bleiben nur Kuba und sein Nachfolgekandidat Venezuela und ein paar lachhafte populistische Pseudodemokratien wie Bolivien und Nicaragua. Doch im übrigen Kontinent funktioniert die Demokratie so einigermaßen, gestützt auf breite gesellschaftliche Mehrheiten, und zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir eine Linke und eine Rechte, die, wie in Brasilien, Chile, Uruguay, Peru, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Mexiko und beinahe ganz Mittelamerika, Gesetz, Meinungsfreiheit, freie Wahlen und Regierungswechsel respektieren. Das ist der richtige Weg, und wenn Lateinamerika nicht von ihm abweicht, die tückische Korruption bekämpft und sich weiter in die Welt integriert, wird es endlich vom Kontinent der Zukunft zum Kontinent der Gegenwart werden.
Ich habe mich in Europa nie und, offen gesagt, nirgendwo je als Ausländer gefühlt. Alle Orte, an denen ich gelebt habe, ob Paris, London, Barcelona, Madrid, Berlin, Washington, New York, Brasilien oder die Dominikanische Republik, waren für mich ein Zuhause. Stets habe ich eine Heimstatt gefunden, wo ich in Frieden leben und arbeiten, Dinge lernen, Hoffnungen nähren, Freunde, gute Bücher und Stoff zum Schreiben finden konnte. Ich glaube allerdings nicht, daß die ganz unbeabsichtigte Tatsache, zu einem Weltbürger geworden zu sein, in mir das geschwächt hat, was man gemeinhin »Wurzeln« nennt, die Bindung an mein eigenes Land – was allerdings auch nicht weiter wichtig wäre –, denn dann wären peruanische Begebenheiten nicht immer noch so präsent in mir als Schriftsteller und in meinen Geschichten, auch wenn diese sich scheinbar weit weg von Peru zutragen. Ich glaube, so lange fern von dem Land gelebt zu haben, in dem ich geboren wurde, hat die Bande vielmehr gestärkt, indem sich zu ihnen ein schärferer Blick und jene Nostalgie fügte, die Nebensächliches und Essentielles zu unterscheiden weiß und die Erinnerungen erglänzen läßt. Die Liebe zu dem Land, aus dem man stammt, kann nicht obligatorisch sein, sondern muß, wie jede andere Liebe auch, einer spontanen Gefühlsbewegung entspringen, wie sie Liebende, Eltern und Kinder, Freunde untereinander vereint.
Peru trage ich tief in mir, weil ich dort geboren, aufgezogen, geformt wurde und dort Kindheits- und Jugenderfahrungen machte, die meine Persönlichkeit prägten, meine Berufung weckten, und weil ich dort liebte, haßte, schwärmte, litt und träumte. Was dort passiert, betrifft mich mehr, bewegt und entrüstet mich mehr als Dinge, die sich anderswo zutragen. Das habe ich nicht gesucht und mir nicht auferlegt, es ist einfach so. Manche meiner Landsleute beschuldigten mich als Verräter, und ich hätte beinahe meine Staatsbürgerschaft verloren, als ich während unserer letzten Diktatur die demokratischen Regierungen der Welt bat, das Regime mit diplomatischen und wirtschaftlichen Sanktionen zu bestrafen, wie ich es bei allen Diktaturen jedweder politischen Richtung immer tat, ob es sich um Pinochet handelte oder um Fidel Castro, um die Taliban in Afghanistan, die Ajatollahs im Iran, die Apartheid in Südafrika oder die Tyrannen in Birma (dem heutigen Myanmar). Und ich würde es morgen wieder tun, sollte Peru – möge das Schicksal es vermeiden und die peruanische Gesellschaft es zu verhindern wissen – erneut Opfer eines Staatsstreich werden, der unsere fragile Demokratie zerstören würde. Ich habe damals aus keinem überstürzten, beleidigten Ressentiment heraus gehandelt, wie aus der Feder einiger Schreiberlinge zu lesen war, die es gewohnt sind, andere mit dem Maßstab ihres eigenen Kleingeistes zu beurteilen. Es war eine Tat in Einklang mit meiner Überzeugung, daß eine Diktatur für ein Land das absolute Böse darstellt, eine Quelle von Brutalität, Grausamkeit und tiefer Wunden ist, die lange nicht heilen, seine Zukunft vergiften und ungute Gewohnheiten und Praktiken hervorbringen, die über Generationen hinweg andauern und den demokratischen Wiederaufbau verzögern. Deshalb müssen Diktaturen ohne Zaudern mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft werden, wirtschaftliche Sanktionen eingeschlossen. Es ist bedauerlich, daß die demokratischen Regierungen, statt ein Beispiel zu geben und Solidarität mit denen zu demonstrieren, die sich wie die Damen in Weiß in Kuba, die venezolanischen Oppositionellen, Aung San Suu Kyi oder Liu Xiaobo mutig den Diktaturen ihres Landes widersetzen, sich häufig weniger wohlwollend gegenüber ihnen als gegenüber ihren Henkern erweisen. All jene, die beherzt für ihre Freiheit kämpfen, treten auch für unsere ein.
Ein Landsmann von mir, José María Arguedas, nannte Peru das Land jedweden Blutes. Meines Erachtens gibt es keine treffendere Definition. Ob wir wollen oder nicht, wir Peruaner tragen dieses jedwede alle in uns: Eine Vielzahl von Traditionen, Rassen, Glaubensvorstellungen und Kulturen aus allen vier Himmelsrichtungen. Ich bin stolz darauf, mich als Erbe der präcolumbianischen Kulturen zu fühlen, der Nazca und Paracas mit ihren herrlichen Stoffen und Überwürfen aus Vogelgefieder, der Moche-Kultur oder der Inkas mit ihren Keramiken, die in den berühmtesten Museen der Welt ausgestellt sind, der Erbauer von Machu Pichu, Gran Chimú, Chan Chan, Kuelap, Sipán, der Sonnen- und der Mondpyramide, und gleichzeitig der Spanier, die mit ihren Satteltaschen, Schwertern und Pferden auch Griechenland und Rom nach Peru brachten, die jüdisch-christliche Tradition, die Renaissance, Cervantes, Quevedo und Góngora und die harte Sprache Kastiliens, die in den Anden geschmeidig wurde. Und mit Spanien kam auch Afrika, das mit seiner Kraft, seiner Musik und seiner übersprudelnden Phantasie die peruanische Heterogenität bereicherte. Schürft man ein wenig unter der Oberfläche, stellt man fest, daß Peru, wie Borges’ Aleph, die ganze Welt in Kleinformat ist. Welch unglaubliches Privileg für ein Land, nicht eine, sondern alle Identitäten zu haben!
Die Eroberung Amerikas war grausam und brutal, wie alle Eroberungen, und wir müssen Kritik an ihr üben, ohne jedoch zu vergessen, daß unter denen, die diese Raubzüge und Verbrechen begingen, viele unsere Urgroßväter und Urururgroßväter waren, die Spanier, die in Amerika blieben und sich dort mit der Bevölkerung vermischten, nicht jene also, die ihr Land nie verließen. Eine gerechte Kritik muß demnach eine Selbstkritik sein. Denn diejenigen, die nach der Unabhängigkeit von Spanien vor zweihundert Jahren in den ehemaligen Kolonien an die Macht kamen, bemühten sich nicht, die Indios zu befreien und sie für das erlittene Übel zu entschädigen, sondern beuteten sie weiter mit der gleichen Habgier und Schonungslosigkeit aus wie die Eroberer, töteten und dezimierten sie in manchen Ländern. Sagen wir es ganz offen: Seit zwei Jahrhunderten tragen allein wir die Verantwortung für die Gleichstellung der Indios, und wir sind ihr nicht nachgekommen. Das ist in ganz Lateinamerika die Aufgabe, die wir noch erfüllen müssen. Es gibt keine einzige Ausnahme für diese Schmach und Schande.
Ich liebe Spanien so sehr wie Peru, und ich schulde ihm soviel wie ich ihm dankbar bin. Ohne Spanien würde ich nie auf diesem Podest stehen, wäre ich kein anerkannter Schriftsteller, würde ich vielleicht dem Kreis der weniger glücklichen Autoren angehören, denen das Schicksal nicht so hold war und keine Verleger, Preise, Leser bescherte, deren Talent vielleicht – geringer Trost – eines Tages die Nachwelt entdeckt. In Spanien wurden alle meine Bücher publiziert und mir wurde dort übermäßige Anerkennung zuteil, Freunde wie Carlos Barral und Carmen Balcells und so viele andere haben sich sehr dafür eingesetzt, daß meine Geschichten eine Leserschaft fanden. In Spanien wurde mir eine zweite Staatsangehörigkeit zuerkannt, als ich meine beinahe verlor. Ich habe es nie als Widerspruch empfunden, Peruaner mit einem spanischen Paß zu sein, denn ich empfand Spanien und Peru immer als die zwei Seiten derselben Medaille, und das nicht nur in bezug auf meine eigene kleine Person, sondern auf so grundlegende Realitäten wie Geschichte, Sprache und Kultur.
Aus all der Zeit, die ich auf spanischem Boden verbracht habe, sind mir in besonders lebendiger Erinnerung die fünf Jahre in meinem geliebten Barcelona Anfang der siebziger Jahre. Die Franco-Diktatur hielt sich noch aufrecht und ordnete noch Erschießungen an, doch sie war bereits ein Fossil in Pantoffeln und vor allem auf kulturellem Gebiet nicht mehr imstande, die einstige Kontrolle auszuüben. Unentwegt öffneten sich Ritzen und Spalte, die es der Zensur nicht zu flicken gelang und durch die der spanischen Gesellschaft neue Ideen, Bücher, Denkströmungen, Werte und künstlerische Formen zukamen, die bis dahin als subversiv verboten waren. Keine Stadt machte von dieser beginnenden Öffnung mehr und besseren Gebrauch als Barcelona, erlebte ein vergleichbares Aufblühen in allen Bereichen des Denkens und des künstlerischen Schaffens. Barcelona wurde zur kulturellen Hauptstadt Spaniens, dem Ort, an dem die kommende Freiheit in der Luft zu schnuppern war. Und in gewisser Weise war es auch die kulturelle Hauptstadt Lateinamerikas, weil sich so viele Maler, Schriftsteller, Verleger und Künstler aus allen lateinamerikanischen Ländern niederließen oder regelmäßig nach Barcelona kamen, weil man dort eben sein mußte, wenn man Dichter, Romancier, Maler oder Komponist unserer Zeit sein wollte. Für mich waren es unvergeßliche Jahre der Kameradschaft, Freundschaften, Verschwörungen und des reichen intellektuellen Schaffens. Wie vorher Paris, war auch Barcelona ein Babylon, eine kosmopolitische, universelle Stadt, anregend zum Leben und Arbeiten, wo sich zum ersten Mal seit dem Bürgerkrieg spanische und lateinamerikanische Schriftsteller vermischten und in der gegenseitigen Sympathie erkannten, daß sie einer selben Tradition entstammten und ein gemeinsames Unterfangen und eine Gewißheit sie verband: daß das Ende der Diktatur nahte und im demokratischen Spanien die Kultur die Hauptrolle einnehmen würde.
Erfüllte sich dies auch nicht ganz, so ist die spanische Transition, der Übergang von der Diktatur zur Demokratie, doch eine der besten Geschichten der modernen Zeit, ein Beispiel dafür, daß die wundersamen Begebenheiten aus den Romanen des magischen Realismus auch in der Wirklichkeit geschehen können, wenn Vernunft und Verstand überwiegen und politische Gegner ihren Sektarismus zugunsten des Gemeinwohls in den Hintergrund stellen. Der Übergang von Autoritarismus zur Freiheit, von Unterentwicklung zu Wohlstand, von einer Gesellschaft mit wirtschaftlichen Gegensätzen und Ungleichheiten eines Drittweltlandes zu einem Land mit stabilem Mittelstand, das binnen weniger Jahre eine demokratische Kultur besaß und sich in Europa integrierte, wurde von der ganzen Welt bewundert und hat die Modernisierung Spaniens rasant beschleunigt. Für mich war es eine bewegende und lehrreiche Erfahrung, diesem Prozeß aus nächster Nähe und zeitweise von innen heraus beizuwohnen. Hoffen wir, daß die nationalistischen Strömungen, unverbesserliche Plage der modernen Welt und auch Spaniens, diese glückliche Geschichte nicht kaputtmachen.
Ich verabscheue jede Art von Nationalismus, eine kurzsichtige, ausschließende Ideologie – oder vielmehr Provinzreligion –, die den geistigen Horizont beschneidet und in ihrem Schoß ethnische und rassistische Vorurteile versteckt, indem sie den zufälligen Geburtsort zum höchsten Wert, zu einem moralischen und ontologischen Privileg erhebt. Neben der Religion war der Nationalismus Anlaß für die schlimmsten Gemetzel der Geschichte, wie die beiden Weltkriege und das aktuelle Blutvergießen im Mittleren Osten. Nichts hat so sehr wie der Nationalismus dazu beigetragen, daß Lateinamerika balkanisiert wurde, daß Blut in unsinnigen Kämpfen und Zwistigkeiten floß und astronomische Summen vergeudet wurden, um Waffen zu kaufen, statt Schulen, Bibliotheken und Krankenhäuser zu bauen.
Man darf den Scheuklappen-Nationalismus und seine Zurückweisung des »anderen«, stets Keim von Gewalt, nicht mit Patriotismus verwechseln, der gesunden, generösen Liebe zu dem Stück Land, auf dem man das Licht der Welt erblickte, wo die eigenen Vorfahren lebten und die ersten Träume entstanden, zu der vertrauten Landschaft aus Geographie, geliebten Menschen und Begebenheiten, die zu Meilensteinen der Erinnerung und Schutzschildern gegen die Einsamkeit werden. Heimat bedeutet weder Flaggen noch Hymnen oder apodiktische Reden über emblematische Helden, sondern eine Handvoll Orte und Menschen, die in unseren Erinnerungen weiterleben und ihnen eine melancholische Note verleihen, es ist die wohlige Gewißheit, immer einen Ort zu haben, an den man zurückkehren kann, egal wo man gerade ist.
Peru ist für mich ein Arequipa, in dem ich geboren wurde, jedoch nie lebte, eine Stadt, die ich durch die Erinnerungen und die Sehnsucht meiner Mutter, ihrer Geschwister und meiner Großeltern kennenlernte, denn meine gesamte Sippe hat, wie alle Arequipaner es zu tun pflegen, die weiße Stadt auf ihrem wanderlustigen Leben stets mit sich getragen. Peru ist das Piura in der Wüste, mit seinen Johannisbrotbäumen und den geduldigen Eselchen, von den Piuranern meiner Jugend fremder Fuß genannt – ebenso schöner wie trauriger Spitzname –, wo ich herausfand, daß die Kinder nicht vom Storch gebracht, sondern von Paaren fabriziert wurden, indem sie Verwerflichkeiten begingen, die Todsünde waren. Es ist für mich die Schule San Miguel und das Theater Variedades, wo ich zum ersten Mal ein von mir geschriebenes Stück auf der Bühne sah. Es ist die Straßenecke Diego Ferré / Colón in dem – wie wir es nannten – Fröhlichen Viertel Miraflores in Lima, wo ich die kurzen Hosen gegen lange eintauschte, meine erste Zigarette rauchte und lernte, wie man tanzte, sich verliebte und Liebeserklärungen machte. Es ist die staubige, heruntergekommene Redaktion der Zeitung La Crónica, wo ich mit sechzehn Jahren meine Laufbahn als Journalist begann. Diesem Beruf sollte ich mich neben der Literatur beinahe mein ganzes Leben lang widmen, und dank ihm habe ich, wie durch die Bücher, mehr erlebt, die Welt besser kennengelernt und bin Menschen von überallher und jeglicher Spezies begegnet, herausragenden, guten, schlechten und verabscheuenswerten Menschen. Peru ist für mich die Militärakademie Leoncio Prado, wo ich erfuhr, daß das Land nicht das kleine Bollwerk der Mittelklasse war, in dem ich bis dahin abgeschirmt und beschützt aufgewachsen war, sondern ein großes, altes Land mit schwärenden Wunden und Ungerechtigkeiten, das von einer Vielzahl gesellschaftlicher Spannungen geschüttelt wurde. Es sind die geheimen Zellen der Widerstandsgruppe Cahuide, in denen wir Handvoll Studenten der Universität San Marcos die Weltrevolution planten. Und Peru sind meine Freunde und Freundinnen von Movimiento Libertad, die sich mit mir drei Jahre lang zwischen Bomben, Stromausfällen und tödlichen terroristischen Anschlägen für die Verteidigung der Demokratie und der Kultur der Freiheit einsetzten.
Und Peru ist Patricia, die Cousine mit der Himmelfahrtsnase und dem unbezwingbaren Charakter, die ich zu meinem Glück vor 45 Jahren heiratete und die immer noch meine Manien, Neurosen und kleinen, zum Schreiben verhelfenden Zornausbrüche erträgt. Ohne sie hätte sich mein Leben vor langer Zeit in einem chaotischen Wirbel aufgelöst, und es wären weder Álvaro noch Gonzalo noch Morgana noch die sechs Enkelkinder geboren worden, die uns fortsetzen und uns das Leben erfreuen. Sie macht alles und sie macht alles gut. Sie nimmt sich der Probleme an, verwaltet die Finanzen, bringt Ordnung ins Chaos, hält Journalisten und Eindringlinge fern, verteidigt meine Zeit, legt Termine und Reisen fest, packt Koffer ein und aus und ist so großzügig, daß selbst ein vermeintlicher Tadel aus ihrem Mund zum schönsten Lob wird: »Mario, du taugst einfach nur zum Schreiben.«
Doch kehren wir zur Literatur zurück. Das Paradies meiner Kindheit ist für mich kein literarischer Mythos, sondern eine Wirklichkeit, die ich in vollen Zügen in unserem großen Familienhaus mit den drei Innenhöfen in Cochabamba lebte, wo ich mit meinen Cousinen und Schulkameraden Episoden von Tarzan und Salgari nachspielte, und später in der Präfektur von Piura, unter deren Dachbalken die Fledermäuse nisteten und die Sternennächte dieser heißen Region mit dem Geheimnis ihrer stummen Schatten erfüllten. In diesen Jahren war das Schreiben für mich ein Spiel, für das ich von meiner Familie gefeiert wurde, ein charmantes Talent, das mir, dem Enkel, Neffen und vaterlosen Sohn, Applaus einbrachte, denn mein Vater war ja gestorben und im Himmel. Ein großer, gutaussehender Herr in Marineuniform, dessen Foto auf meinem Nachttisch ich jeden Abend vor dem Schlafengehen nach einem Gebet küßte. An einem Morgen in Piura, von dem ich mich möglicherweise bis heute nicht erholt habe, enthüllte mir meine Mutter, daß dieser Herr in Wirklichkeit noch am Leben war. Und daß wir noch am selben Tag zu ihm nach Lima ziehen würden. Ich war damals elf Jahre alt, und nichts sollte mehr sein wie zuvor. Ich verlor meine Unschuld und lernte die Einsamkeit kennen, die Autorität, das Erwachsenenleben und die Angst. Meine Rettung war das Lesen, das Lesen guter Bücher, die Flucht in diese Welten, in denen das Leben mitreißend und kraftvoll war, ein Abenteuer auf das nächste folgte, wo ich mich frei fühlen konnte und wieder glücklich war. Und das Schreiben, dem ich heimlich nachging wie einem unaussprechlichen Laster, einer verbotenen Leidenschaft. Die Literatur hörte auf, ein Spiel zu sein. Sie wurde zu einer Form, den Widrigkeiten standzuhalten, zu protestieren, zu rebellieren, vor dem Unerträglichen zu fliehen, sie wurde zum Sinn meines Lebens. Seitdem und bis heute, immer wenn ich mich bedrückt, niedergeschlagen oder am Rand der Verzweiflung fühlte, wurde das Schreiben, dieses mit Leib und Seele Geschichten erzählen, zum Licht am Ende des Tunnels, zum Rettungsfloß, das den Schiffsbrüchigen ans Ufer bringt.
Auch wenn es mich viel Arbeit und Schweiß kostet und ich mich bisweilen, wie jeder Schriftsteller, von Lähmung oder versiegender Phantasie bedroht fühle, hat mir nichts im Leben solchen Genuß verschafft wie Monate oder Jahre mit der Schaffung einer Geschichte zuzubringen, von ihrem ungewissen ersten Anbeginn, dem in der Erinnerung von irgendeinem erlebten Moment aufbewahrten Bild, das zu Unruhe, Begeisterung, Fabuliererei wurde und schließlich zum Keim des Projektes und Entschlusses, diesen von Phantomen bevölkerten Nebel in eine Geschichte zu verwandeln. Schreiben ist eine Art zu leben, sagte Flaubert. Ja, ganz gewiß, eine Art, mit Illusion und Freude und feurigen Funken im Kopf zu leben und dabei mit widerspenstigen Wörtern zu ringen, bis man sie gebändigt hat, die weite Welt zu erforschen wie ein Jäger auf der Pirsch nach guter Beute, um die erwachende Fiktion zu nähren und den gierigen Appetit zu besänftigen, mit dem jede anwachsende Geschichte am liebsten alle anderen Geschichten verschlingen würde. Den Schwindel zu verspüren, den ein entstehender Roman hervorruft, wenn er Form annimmt und ein Eigenleben entwickelt, mit Figuren, die sich regen, handeln, denken, fühlen und Respekt und Beachtung einfordern, denen man nicht mehr willkürlich ein bestimmtes Verhalten aufzwingen, die man nicht mehr ihres freien Willens berauben kann, ohne sie damit zu töten, ohne daß die Geschichte ihre Überzeugungskraft verliert, das ist eine Erfahrung, die mich immer noch verzaubert wie beim ersten Mal, die mich erfüllt und taumeln läßt wie ein über Tage, Wochen und Monate andauernder Liebesakt mit der geliebten Frau.
Wenn ich von Literatur sprach, habe ich mich immer viel auf den Roman und wenig aufs Theater bezogen, eine weitere hohe Form der Fiktion. Womit ich ihm natürlich großes Unrecht tat. Das Theater war meine erste Liebe, seit ich als Jugendlicher im Teatro Segura in Lima Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden gesehen habe, was einen so überwältigenden Eindruck in mir hinterließ, daß ich daraufhin ein Theaterstück über die Inkas schrieb. Hätte es im Lima der fünfziger Jahre neue Strömungen im Theaterbereich gegeben, wäre ich Dramaturg statt Romancier geworden. Doch es gab sie nicht, und das führte wohl dazu, daß ich mich mehr und mehr der erzählenden Prosa zuwandte. Trotzdem nahm meine Liebe zum Theater nie ab, hingekauert döste sie im Schatten meiner Romane, Versuchung und Nostalgie zugleich, vor allem, wenn ich irgendein besonders beeindruckendes Stück sah. Ende der siebziger Jahre kam ich durch die hartnäckige Erinnerung an meine hundertjährige Tante Mamaé, die in den letzten Jahren ihres Lebens der Realität den Rücken gekehrt und sich in Erinnerung und Imagination geflüchtet hatte, zu einer Geschichte. Ein verhängnisvolles Gefühl sagte mir, daß dies eine Geschichte fürs Theater sei, daß sie nur auf einer Bühne Leben und Glanz einer gelungenen Fiktion erlangen würde. Ich schrieb sie mit dem aufgeregten Zittern eines Anfängers und freute mich so sehr daran, sie mit Norma Aleandro in der Hauptrolle auf der Bühne zu sehen, daß ich seitdem, zwischen zwei Romanen, zwei Essays, mehrmals rückfällig geworden bin. Doch nie hätte ich mir träumen lassen, daß ich mit siebzig Jahren einmal selbst als Schauspieler auf eine Bühne steigen (oder vielmehr genötigt werden) würde. Dieses waghalsige Abenteuer ließ mich, der ich mein Leben lang Fiktion geschrieben habe, zum ersten Mal am eigenen Leib das Wunder erfahren, für einige Stunden eine imaginäre Figur zu verkörpern, die Fiktion vor einem Publikum zu inkarnieren. Ich werde meinen Freunden, dem Regisseur Joan Ollé und der Schauspielerin Aitana Sánchez Gijón, nie genug dafür danken können, mich animiert zu haben, diese herrliche Erfahrung mit ihnen zu teilen (trotz der Panik, die sie begleitete).
Die Literatur ist eine trügerische Darstellung des Lebens, trotzdem hilft sie uns, es besser zu verstehen, uns in dem Labyrinth zurechtzufinden, in das wir geboren werden, in dem wir leben und sterben. Sie entschädigt uns für die Rückschläge und Frustrationen, die uns das wahre Leben zufügt, und dank ihr entschlüsseln wir zumindest einen Teil der Hieroglyphen, die das Dasein für den Großteil der Menschen birgt, vor allem für diejenigen, die wir mehr Zweifel als Gewißheiten haben und unsere Ratlosigkeit eingestehen angesichts so weitreichender Themen wie der Transzendenz, dem individuellen und kollektiven Schicksal, der Seele, dem Sinn oder der Sinnlosigkeit der Geschichte, dem Diesseits und Jenseits der rationalen Erkenntnis.
Es hat mich immer fasziniert, mir jenen unbestimmten Moment vorzustellen, in dem unsere Vorfahren, die sich noch kaum von den Tieren unterschieden und sich gerade erst langsam mittels einer Sprache verständigen konnten, um das Lagerfeuer ihrer Höhlen herum saßen, während draußen in der Winternacht etliche Bedrohungen grollten – Donner, Blitze, Raubtierbrüllen –, und sich gegenseitig erfundene Geschichten erzählten. Das war der entscheidende Moment in unserer Entwicklung, denn mit diesem Kreis primitiver Wesen, die gebannt einer Stimme und der Phantasie des Erzählers lauschten, begann die Zivilisation, in deren langem Verlauf wir nach und nach zu einem Menschtum gelangen, das eigenständige, von der Sippe abgelöste Individuum erschaffen würden, Wissenschaften, Künste, Rechtsprechung und Freiheit, das Innere des menschlichen Körpers wie das Universum erforschen und bis zu den Sternen reisen sollten. Jene Geschichten, Fabeln, Mythen und Legenden, die zum ersten Mal wie eine neue Musik für die von den Geheimnissen und Gefahren einer fremden, bedrohlichen Welt eingeschüchterten Zuhörerschaft erklang, mußten ein erquickendes Bad in einem stillen Gewässer darstellen für diese stets in Alarmbereitschaft befindlichen Gemüter, deren Dasein vor allem aus Essen, Obdachsuche, Töten und Geschlechtstrieb bestand. Von dem Moment an, in dem sie, angeregt von den Geschichtenerzählern, gemeinsam zu träumen, ihre Träume zu teilen begannen, befreiten sie sich aus dem Joch des Überlebens, diesem Strudel aus verrohenden Tätigkeiten, und ihr Leben wurde Traum, Freude, Imagination, ein revolutionäres Vorhaben: aus der Isolierung zu treten, die Dinge zu verändern und zu verbessern, die Sehnsüchte zu stillen und Bestrebungen zu bekämpfen, die ihnen von den erfundenen Leben eingegeben wurden, der Neugierde nachzugehen, das Unbekannte zu lichten, von dem sie umgeben waren.
Dieser Prozeß setzte sich ununterbrochen fort und erfuhr eine große Bereicherung, als die Schrift entstand und die Geschichten nicht mehr nur gehört, sondern auch gelesen werden konnten und damit das Fortbestehen erreichten, das ihnen die Literatur ermöglicht. Deshalb gilt es, unermüdlich zu wiederholen, bis auch die neuen Generationen davon überzeugt sind: Die Fiktion ist mehr als Unterhaltung, mehr als eine geistige Übung, die Sensibilität und kritischen Geist schärft. Sie ist eine unerläßliche Notwendigkeit für das Fortbestehen der Zivilisation, für ihre Erneuerung, zur Bewahrung der besten Seiten des Menschlichen. Damit wir nicht in die Barbarei der Kommunikationslosigkeit zurückgeworfen werden und das Leben sich nicht auf den Pragmatismus der Fachleute reduziert, die eine tiefe Einsicht in die Dinge erlangen, aber nicht wissen, was sie umgibt, ihnen vorausgeht und folgt. Damit wir nicht zu Dienern und Sklaven der Maschinen werden, die wir erfinden, um uns ihrer zu bedienen. Und weil eine Welt ohne Literatur auch eine Welt ohne Sehnsüchte, Ideale oder Auflehnung wäre, eine Welt voller Automaten, denen fehlen würde, was das menschliche Wesen wirklich menschlich macht: Die Fähigkeit, sich aus sich selbst heraus in einen anderen zu versetzen, in viele andere, aus dem Ton unserer Träume modelliert.
Von der Höhle zum Wolkenkratzer, vom Knüppel zu Massenvernichtungswaffen, vom tautologischen Leben in der Sippe zur Ära der Globalisierung, hat die Literatur die menschlichen Erfahrungen vervielfacht, indem sie verhindert, daß wir Menschen der Lethargie, Verschlossenheit und Resignation anheimfallen. Nichts hat so sehr die Unrast gesät, Phantasie und Sehnsüchte gefördert, wie dieses Leben aus Lügen, das wir dank der Literatur unserem eigenen hinzufügen, um selbst große Abenteuer und Leidenschaften zu erleben, wie sie das wirkliche Leben uns niemals vergönnen wird. Die Lügen der Literatur werden wahr durch uns, die von ihr veränderten, von ihren Sehnsüchten angesteckten Leser, und durch die Schuld der Fiktion leben wir in beständigem Zwist mit der mittelmäßigen Wirklichkeit. Die Literatur ist ein Zauberwerk, das uns vorgaukelt, zu haben, was wir nicht haben, zu sein, was wir nicht sind, eine unmögliche Existenz zu führen, in der wir uns wie heidnische Götter irdisch und unsterblich zugleich fühlen, und das damit die Unangepaßtheit und Rebellion in unseren Köpfe keimen läßt, wie sie allen großen Taten zugrunde liegen, die zu einer Verringerung der Gewalt in den menschlichen Beziehungen beigetragen haben. Zu ihrer Verringerung, nicht ihrer Abschaffung. Denn unsere Geschichte wird zum Glück immer unvollendet sein. Und deshalb müssen wir weiter träumen, lesen und schreiben, die wirksamste Form, die wir gefunden haben, unsere vorübergehende Existenz zu erleichtern, das Nagen der Zeit zu besiegen und das Unmögliche möglich zu machen.
Stockholm, 7. Dezember 2010
Übersetzung von Angelica Ammar
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.